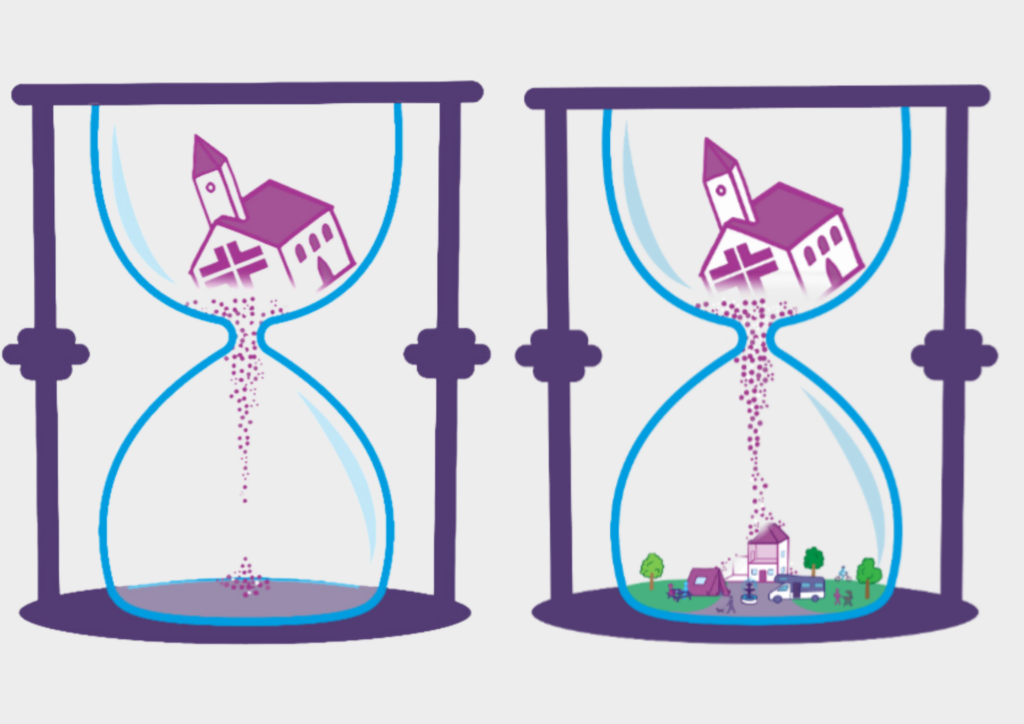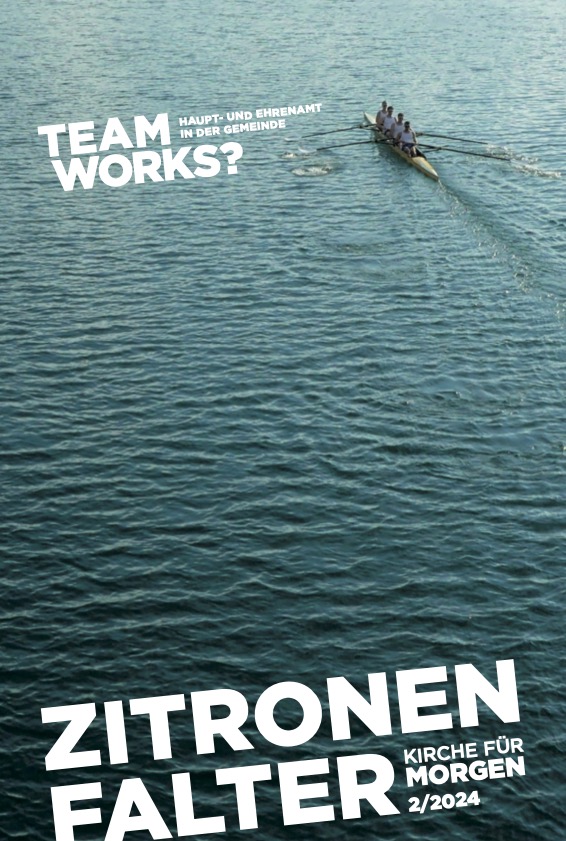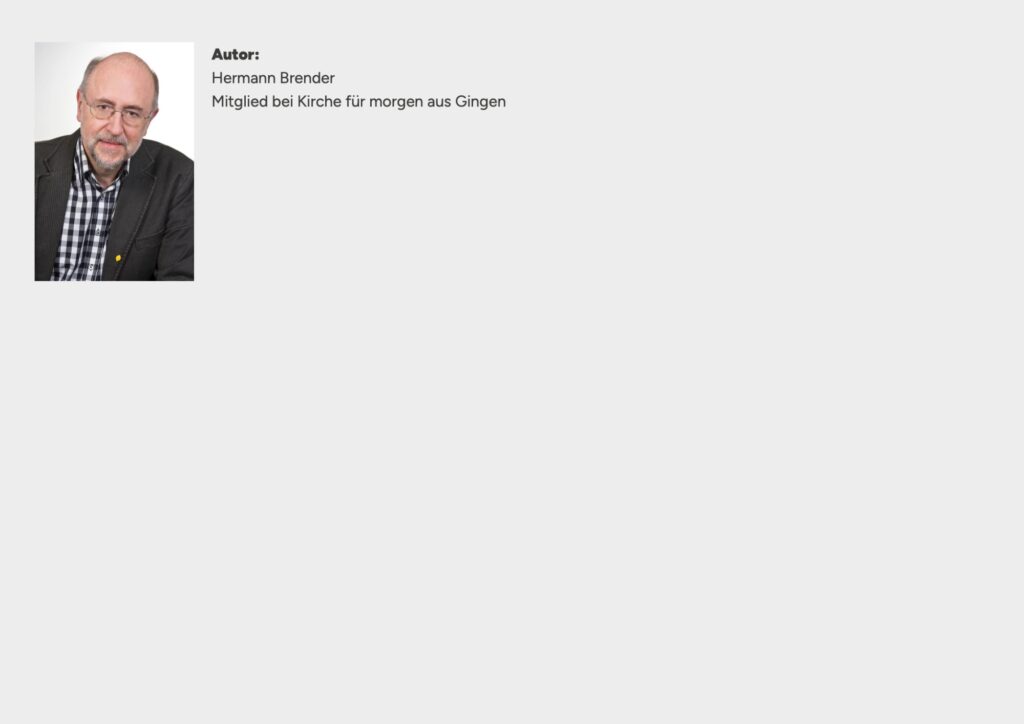Bericht TOP 7 und Anträge

Weil die Einnahmen der Landeskirche zurückgehen und gleichzeitig die Pensionsaufwendungen steigen, muss die Landeskirche massiv sparen. Der Haushalt soll um rund 100 Millionen Euro pro Jahr reduziert werden. Dazu hat der Oberkirchenrat eine sogenannte „Priorisierungsliste“ vorgelegt, in der mögliche Einsparpotenziale benannt werden.
Sparzwang in den notwendigen Dimensionen fordert große Opfer und eine Abwägung von Prioritäten. Es gehört zur synodalen Verantwortung, nicht nur die Dinge zu benennen, die uns erhaltenswert erscheinen oder für die wir meinen, kirchenpolitische Lobbyarbeit betreiben zu müssen – sondern auch zu sagen, wofür wir zukünftig kein Geld mehr ausgeben wollen.
Dieser Fragestellung, die auch zur Ehrlichkeit kirchenpolitischen Handelns gehört, hat sich ausschließlich der Gesprächskreis Kirche für morgen gestellt.
„Spardiskussionen sind immer auch Kirchenbilddiskussionen“ sagte Matthias Böhler im Gesprächskreisvotum. „Die Optimierungslogik reicht für eine zukunftsfähige Kirche nicht aus. Spardiskussionen ohne Kirchenbild-Diskussionen sind uns zu passiv. Passivität bedeutet Stillstand. Wer passiv ist kann nur reagieren, wer gestalten will, muss aktiv werden und wissen, wo er hin will.“
Vier Forderungen stellten wir als Gesprächskreis mit Blick auf die Spardiskussionen der nächsten Wochen auf. Neben der Abschaffung des Beamtentums, treten wir für eine überproportionale Förderung der Jugendarbeit und des Ehrenamts ein, schlagen die Abgabe sämtlicher evangelischer Tagungsstätten vor und setzen uns für eine schlanke und effektive Verwaltung ein.
Britta Gall brachte dazu den Antrag 10/25 (Abgabe der Ev. Tagungsstätten Württemberg) ein. Dieser Antrag trägt den Geist des Kirchenbilds von Kirche von morgen, indem „Menschen statt Steine“ klar priorisiert werden oder, konkreter gesagt, „Hotelbetten und Räume“, zugunsten von gestärkten Inhalten aufzugeben sein werden.
„Die gestellte Aufgabe an uns lautet dennoch: Priorisieren. Fokussieren. Volle Kraft in die kirchlichen Kernaufgaben. Zu diesen Kernaufgaben einer Kirche der Zukunft gehört unserer Meinung nach, der Meinung von Kirche für morgen, die Finanzierung von Beherbergungsbetrieben nicht.“, so Britta Gall. Denkbar sind für uns aber auch alternative Trägerstrukturen, die in gemeinsamer Verantwortung zu entwickeln und zeitnah zu ermöglichen sein sollten.

Der Antrag 16/25 (Abschaffung der Prälaturen), der von Kai Münzing eingebracht wurde, trägt ebenfalls diesen Geist. Aufgeblähte Organisationsstrukturen müssen angepasst und Hierarchien abgebaut werden. Die Kirche der Zukunft wird eine Ehrenamtskirche sein und vor Ort leben. Wir setzen auf die Leitungskompetenzen der mittleren Ebene und möchten diese stärken und ausbauen.
– Von Matthias Böhler und Kai Münzing
Die Finanzsituation der Landeskirche auf den Punkt gebracht:
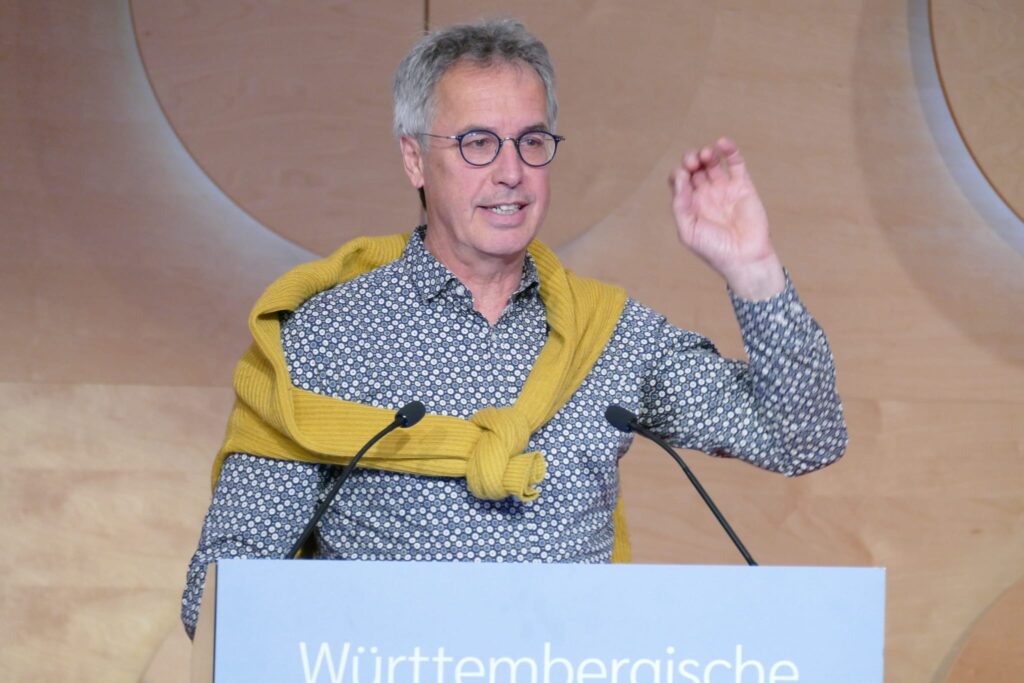
- Die krisenhafte Wirtschaftslage sowie der andauernde Mitgliederrückgang wirken sich massiv auf die Kirchensteuereinnahmen aus.
- Für 2025 prognostiziert das Finanzdezernat einen Rückgang des Kirchensteueraufkommens auf 780 Mio. Euro.
- Im Vergleich zu den Ausgaben ergibt sich in den kommenden Haushaltsjahren ein jährliches Strukturdefizit von über 40 Mio. Euro
- Für die zukünftigen Versorgungsbezüge der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten müssen wir eine weitere Milliarde ansparen und dafür werden wir 12 Jahre lang jährlich 80 Mio. ansparen.
Einsparungen und Herausforderungen:
- Ziel ist es, bis 2028 wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.
- Dazu müssen in den nächsten Jahren 103,9 Millionen Euro im jährlichen Haushalt der Landeskirche eingespart werden.
- In der Eckwerteplanung wird der Verteilbetrag für Kirchengemeinden in den kommenden Jahren jeweils um 0,6 Prozent erhöht. Damit können die Kostensteigerungen von Löhnen und Gehälter nicht ausgeglichen werden. Das bedeutet, dass auch die Kirchengemeinden und -bezirke Einsparungen vornehmen müssten.
- „Das heißt im Klartext: Wir werden kleiner, wir haben weniger Stellen, weniger Sachmittel, weniger Immobilien, weniger Ausbildungsplätze, weniger Servicestellen in der Verwaltung usw.“ so im synodalen Bericht von Direktor Werner auf der Synode.
Strategien und Maßnahmen:
- Die geplanten Einsparungen sind in der Priorisierungsübersicht zusammengefasst. Diese ist öffentlich und kann im elkwue-Portal eingesehen werden. Ebenso sind dort die Berichte aus dem OKR sowie die Gesprächskreisvoten nachzulesen.
- Bis zur Sommersynode 2025 werden diese Einsparvorschläge und die eingebrachten Änderungsanträge aus der Synode heraus in den Ausschüssen diskutiert und beraten. In der Synodaltagung im Juli erwarten wir die Beschlüsse und Entscheidungen.
– Von Götz Kanzleiter
Antrag und Gesetzesvorlage durch den OKR: Ergänzung Trauagende

Der OKR bringt den Antrag 11/25 ein. Darin geht es um die Ergänzung des Gottesdienstbuches (Teil 2: Kirchliche Trauung) um die Liturgie „Trauung von Ehepaaren gleichen Geschlechts“ samt Texten zur Auswahl und Anhang. Zugleich wurde das kirchliche Gesetz zur Änderung des Rechts der kirchlichen Trauung (Beilage 127) eingebracht.
In der Aussprache zur Verweisung des Antrags wurde betont, dass die Gruppierungen in der Synode doch bitte im geschwisterlichen Gespräch zu diesem Thema bleiben sollen, auch wenn es hier unterschiedliche Sichtweisen gibt.
Oliver Römisch sieht es in seiner Stellungnahme kritisch, dass Kirchengemeinden in der momentanen Fassung gezwungen werden sollen, sich gegen die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare entscheiden zu müssen. Er glaubt nicht, dass dies zu einer Befriedung des Themas führen wird. Es müsste in den Ausschüssen im Blick auf die Drei-Viertel-Mehrheit über eine Vereinfachung nachgedacht werden. „Die Kirchengemeinden sollen weiterhin darüber entscheiden, ob sie es einführen oder nicht – und das mit einfacher Mehrheit.“
Auch Matthias Vosseler spricht sich für eine Verweisung aus, um daran in den Ausschüssen weiterarbeiten zu können. Er bedauert es, zusammen mit dem Synodalen Burkard Frauer (Vorredner), dass der bisherige Gesprächsweg und der aus der Synode eingebrachte Antrag 23/23 leider nicht aufgenommen wurden.
Beides – Antrag und Gesetzentwurf – wurde in den Theologischen Ausschuss und den Rechtsausschuss verwiesen.
-Von Bernd Wetzel
Eröffnungsgottesdienst der Synode

Der Eröffnungsgottesdienst in der Hospitalkirche wurde von ‚Kirche für morgen‘ gestaltet.
Aus der Formation WeJazz begleiteten Theodora Kaiser und Benjamin Steinhoff den Gottesdienst und sangen mit und für uns: Church-Songs im Jazz-Folk-Blues Stil.
Die Predigt richtete den Blick auf Petrus, den Superjünger, der in der Passionsgeschichte so versagt hatte und Jesus verleugnete. Matthias Vosseler predigte über die Schuld des Petrus, die nicht verschwiegen wird. Doch trotz seines Versagens geriet Petrus nicht in Vergessenheit, sondern wurde von Gott neu berufen.
Der Gottesdienst wurde aufgezeichnet und auf folgenden Kanälen zu sehen:
Sowie bei Regio TV, 6.+13.+20.+27. April, 11 und 13 Uhr
– Von Matthias Vosseler
Einladung zum Forum 2025 in Denkendorf

Am 10. Mai wollen gemeinsam diskutieren und mutige Ideen für eine zukunftsfähige Kirche entwickeln – kreativ, visionär und voller Aufbruchskraft.
Mit dabei sind Referenten: Dr. Golde Hannah Marie Wissner, Cyrill Schwarz und Dr. Gisela Schneider.
Weitere Infos und Anmeldung: Forum 2025