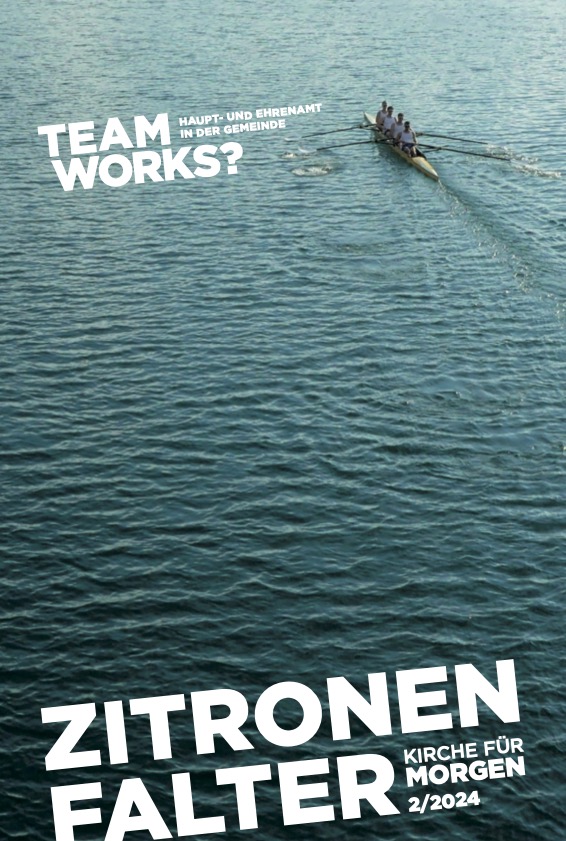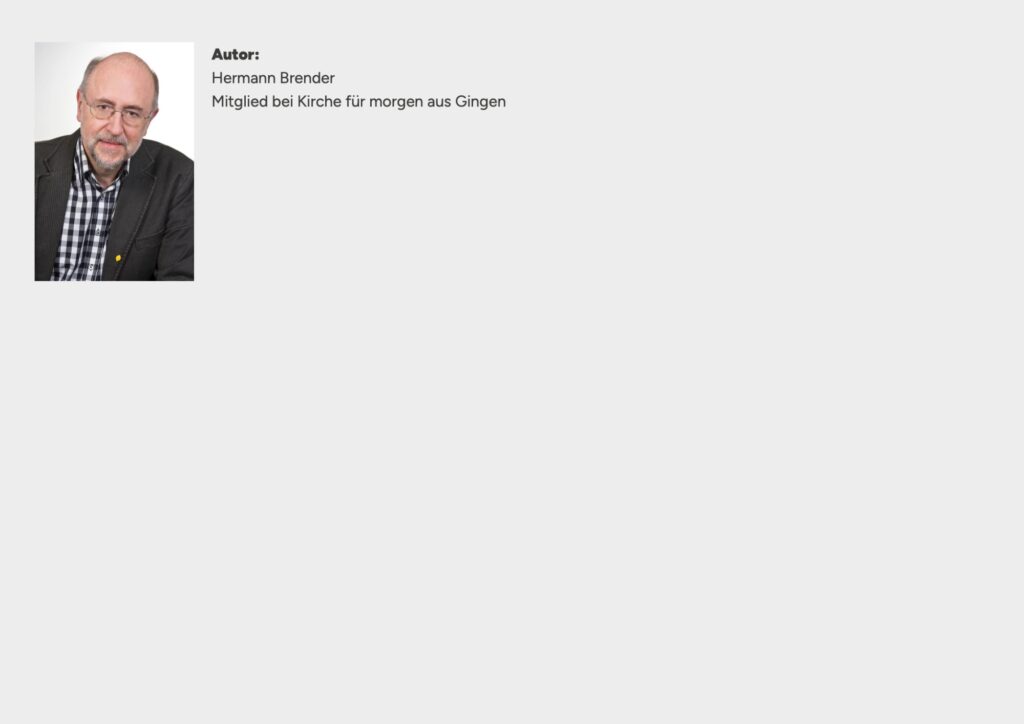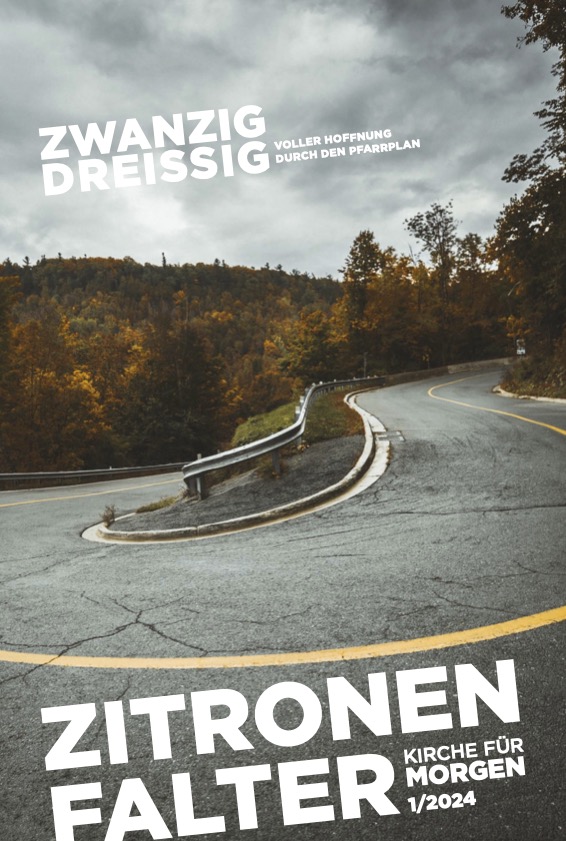Die Zusammenarbeit von unterschiedlich ausgebildeten Menschen in der Leitung einer christlichen Gemeinschaft oder einer Kirchengemeinde ist eine große Herausforderung. Gleichzeitig kann sie aber auch eine enorme Bereicherung für die beteiligten Menschen sein. Die Dynamik, die in transprofessionellen Teams liegt, kann sich auf das Zusammenleben in einer Gemeinschaft im engeren Sinne, aber auch auf kirchengemeindliche Strukturen und Begegnungen im weiteren Sinne auswirken.
In der Zusammenarbeit von verschiedentlich ausgebildeten Menschen als Leitungs-Team ist nicht die Profession das Wesentliche, sondern die Professionalität in der Ausführung der jeweiligen Aufgabe und Tätigkeit. Die Etablierung von transprofessionellen Teams in Kirchengemeinden erfordert ein gewisses Maß an Veränderungsbereitschaft bei der bisherigen Kirchenleitung und den Gemeindegliedern. Denn: sie stellt die bisherigen Leitungsformen auf den Kopf. Dabei ist die Grundidee keine neue. Schon im Neuen Testament lesen wir von unterschiedlichen Gaben und Aufgaben in der Gemeinde. Selbst die wichtigen Texte der Christenheit stammen nicht etwa aus einer Feder, sondern wurden von Menschen mit unterschiedlicher Profession abgefasst: Lukas etwa war Historiker, Paulus hingegen Zeltmacher. Das Evangelium braucht verschiedene Perspektiven und Betrachtungsweisen, um ganz zum Leuchten zu kommen. Das kann auch uns ermutigen, Gemeindearbeit viel stärker als Teamplay zu verstehen.
In der Church of England macht man die Erfahrungen, dass insbesondere im Team geleitete Gemeinden für Neugründungen verantwortlich sind. Oder dass sie einen Zuwachs an Gemeindegliedern erfahren haben.
Transprofessionelle Teams sind aber kein Allheilmittel für die strukturelle Probleme in einer Volkskirche, die von Kirchenaustritten und demographischem Wandel geprägt ist. Sie sollten auch nicht zuerst als Mittel zur Optimierung kirchengemeindlichen Handelns oder für die gesellschaftlich gewünschte Öffnungen in den Sozialraum gesehen werden. Worum es geht, ist ein grundsätzlich anderes Handeln. Um ein Leitungshandeln, das aus der geistlichen Gemeinschaft und von den Kirchengemeindemitgliedern heraus entspringt. Diese partizipativen Ansätze stärken das Zugehörigkeitsgefühl und verbinden Menschen auf eine tiefere Weise. In gemeindlicher Teamarbeit geht es vor allem darum, einander so zu dienen, wie Jesus seinen Jüngern gedient hat.
In Leitungsposition der Kirche braucht es in Zukunft also Menschen, die sich nicht als alleinigen Verantwortlichen sehen, wie über viele Jahrhunderten hinweg das Pfarramt gedacht war. Es braucht Teamplayerinnen und Teamplayer, die in der Lage sind, sich in ihrer Unterschiedlichkeit zu ergänzen, sodass sie als Leitungsteam der Gemeinde dienen.
Nicht nur die Zusammensetzung, sondern auch die Starrheit kirchlicher Leitung muss in Zukunft aufgebrochen werden. Teammitglieder müssen nicht für immer und für alles Verantwortung übernehmen. So kann es für die Umgestaltung von Gemeinderäumen beispielsweise sinnvoll sein, dass eine Bauingenieurin und ein Elektromeister zeitweise mit in der Verantwortung sind. Für die Einführung neuer Gottesdienstformen, sind dann wieder andere Menschen im Leitungsteam sinnvoll.
Die Idee von transprofessionellen Teams fördert solche fluideren Formen der Zusammenarbeit, weil sie danach fragt, wer für eine bestimmte Aufgabe geeignete Fähigkeiten mitbringt und nicht, wer für die Aufgabe zuständig ist. Daraus resultieren effektivere und Ressourcen sparende Arbeitsabläufe, was zu mehr Zufriedenheit der Mitwirkenden führt. Wer sich gebraucht und am richtigen Platz fühlt, der empfindet seine Arbeit als sinnvoll und kann im besten Fall Energie daraus schöpfen. Wenn kirchliche Prozesse besser im Team oder als netzwerkorientierte Zusammenarbeit gedacht wären, könnten sich neue Freiräume für Weiterentwicklung und innovative Ideen ergeben.
Teamarbeit in der Zukunft der Kirche ist notwendig, damit Kirche wieder mehr Zustimmung und Bedeutsamkeit innerhalb der eigenen Gemeindeglieder, wie auch innerhalb er Gesellschaft erfährt.
Autorin Anna Weister-Andersson
ist eine schwedische Singer – Songwriterin für Gospelmusik, leitete mehrere und unterschiedliche Gospelchöre in Schweden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann lebte Anna etliche Jahre in Großbritannien in zwei christlichen Gemeinschaften, wo sie auch als Worship-Leiterin aktiv war.

Kleines Lexikon der Teamarbeit
Multiprofessionell: Menschen mit unterschiedlichem beruflichem Hintergrund arbeiten zusammen. Jede:r parallel mit klarer Rolle in seinem Fach- und Zuständigkeitsgebiet.
Interprofessionell: Ähnlich wie multiprofessionell, aber Ziele aller Bereiche werden gemeinsam festgelegt und Entscheidungen zusammen verantwortet. Jede:r arbeitet dann parallel in seinem Fachgebiet.
Transprofessionell: Nicht nur Ziele und Entscheidungen sind gemeinsame Sache, sondern auch die eigentliche Arbeit erfolgt nicht in Zuständigkeitsbereichen, sondern interaktiv und partnerschaftlich.
Nach: Daniela Schmitz & Tobias Schmohl: Handbuch Transdisziplinäre Didaktik, S. 357.